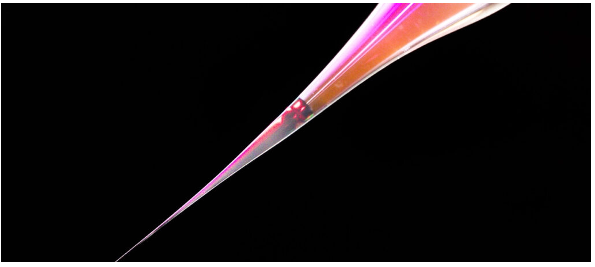Herzlich willkommen beim diatec weekly,
sie ist das Rückgrat jeder Demokratie, auch der unsrigen, und soll verhindern, dass zu viel Macht in einer Hand liegt – die Rede ist von Gewaltenteilung. Deshalb gibt es die Legislative für die Gesetzgebung, die Exekutive für die Umsetzung und die Judikative, die darüber wacht, dass alles auch korrekt umgesetzt wird. Dazu gesellt sich die sogenannte vierte Gewalt – die Medien. Laut, schrill, empört und omnipräsent kommentieren sie im gefühlten Sekundentakt jede politische Äußerung, als hinge das Schicksal der Republik am neuesten Gesetzentwurf zur Plastikflasche.
Doch während sich Öffentlichkeit und Presse an Schlagzeilen abarbeiten, wirkt im Hintergrund eine fünfte und weitaus leisere Macht: der Lobbyismus. Gut vernetzt, hervorragend informiert und bestens positioniert flüstert er den Entscheidern ins Ohr, oft erfolgreicher, als jeder Leitartikel oder Talkshow im Spätprogramm. Der Lobbyist tritt selten ans Mikrofon, dafür umso öfter an die Hintertür und wenn er etwas will, bekommt er es auch nicht selten und zwar diskret, effizient und ohne zuviel Aufmerksamkeit.
Lobbyismus ist ein Wort, das bei vielen sofort Alarmglocken schrillen lässt. Korruption, Machtmissbrauch und dubiose Hinterzimmerdeals scheinen mitzuschwingen, dabei war der Begriff ursprünglich ganz harmlos und eher höflich gemeint. Seinen Ursprung hat er im 18. Jahrhundert, als gut betuchte Bürger und Handwerksvertreter in der Lobby des britischen „House of Commons“ geduldig warteten, um bei einem der Abgeordneten Gehör für ihr Anliegen zu finden. So richtig populär wurde der Begriff dann in den USA: Präsident Ulysses S. Grant soll sich bevorzugt im Willard Hotel in Washington D.C. aufgehalten haben und weil dort allerlei Interessenvertreter in der Hotellobby auf ihn warteten, nannte Grant sie kurzerhand: Die Lobbyisten. Der Begriff war geboren und ging um die Welt.
Und heute? Lobbyismus ist ein Werkzeug und nicht per se schlecht. Wie bei jedem Werkzeug gilt: Man kann damit etwas bauen oder etwas zerstören. In einer modernen Demokratie ist Lobbyismus zunächst einmal Ausdruck einer pluralistischen Gesellschaft: Unternehmen, Gewerkschaften, Umweltverbände, Kirchen oder Sozialträger – sie alle haben Interessen und wollen diese kundtun. Idealerweise bereichern sie den politischen Prozess mit Fachwissen, Erfahrung und Perspektiven, die in keinem Gesetzesentwurf fehlen sollten. Denn kein Ministerium – so durchorganisiert es auch sein mag – kann im Alleingang alle Wechselwirkungen politischer Entscheidungen durchdringen. Beratung von außen ist immer notwendig und auch erwünscht.
Problematisch wird es, wenn einige Stimmen lauter sind als andere, weil sie mit mehr Geld, besseren Netzwerken oder schlicht mehr Personal auftreten. Interessensgruppen wie DAX-Konzerne, Banken und große Kanzleien haben praktisch ständigen Zugang zur politischen Spitze. Anderen und gemeinnützigen Initiativen oder Verbraucherorganisationen fehlt es an der nötigen Schlagkraft. So krankt der deutsche Lobbyismus an Intransparenz und Ungleichgewicht und lässt ein Machtgefälle zu, das demokratische Prinzipien aushöhlt. Der Fall um den Masken-Skandal während der Corona-Pandemie oder die enge Verflechtung mancher Politiker mit der Energiewirtschaft sind bekannte Auswüchse.
Das bekannteste Beispiel über die Macht von strategisch gut eingesetztem Lobbyismus ist die Cum-Ex-Affäre, ein riesiges Steuerbetrugsnetzwerk, das man als unbedarfter Bürger trotz der gut gemachten acht-teiligen ZDF-Serie immer noch nicht wirklich verstanden hat. Aber wir versuchen es mal:
Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien rasend schnell zwischen verschiedenen Akteuren hin- und hergeschoben – teils per Leerverkauf, teils mit echtem Besitzwechsel. Ziel war es, dem Staat zu suggerieren, es gäbe mehrere Anspruchsberechtigte auf die Rückerstattung von Kapitalertragsteuer, obwohl diese nur einmal gezahlt, aber mehrfach zurückgefordert wurde. Möglich war das, weil die Abführung der Steuer anonymisiert war und die Finanzämter keine Prüfung durchführten, ob die Steuer überhaupt gezahlt worden war. Es reichte aus, ein entsprechendes Formular vorzulegen. Und das war erst der Anfang. In einem zweiten Schritt wurden dann Aktien schlichtweg „leer verkauft“, also ohne sie überhaupt zu besitzen. Auch dafür wurde die Kapitalertragsteuer zurückgefordert, obwohl sie nie gezahlt wurde.
Das System funktionierte so gut, dass Banken und Berater begannen, gezielt Modelle zu entwickeln, um diesen Mechanismus zu perfektionieren. Mit enormem juristischem Aufwand und komplexen Konstruktionen wurde der Staat über Jahre hinweg systematisch ausgeplündert – unter den Augen von Behörden, Ministerien und politischer Führung.
Die Cum-Ex-Affäre ist nicht nur ein Fall krimineller Energie, sondern auch ein Lehrstück über die stille Macht des Lobbyismus. Über Jahre hinweg nutzten Banken, Kanzleien und Investoren ein Steuerschlupfloch, das längst hätte geschlossen sein können, wäre da nicht ein Netzwerk diskreter Einflussnahme gewesen. Gut platzierte Lobbyisten sorgten mit juristischen Gutachten, persönlichen Gesprächen und professioneller Vernebelung dafür, dass politisches Handeln ausblieb, obwohl Fachleute längst gewarnt hatten. So wurde aus einem Graubereich ein Milliardenbetrug, weniger, weil Gesetze fehlten, sondern der Wille, sie zu verstehen und auch umzusetzen. Es waren Lobbyisten, die geschickt Unsicherheiten im Steuerrecht genutzt und Einfluss auf Gesetzesformulierungen genommen haben. Mit juristischen Tricks wurden Durchsuchungen verhindert oder verzögert und ein System, das auf Vertrauen basiert, wurde mit Kalkül ausgehöhlt und viel zu lange toleriert.
Wer immer noch glaubt, Lobbyismus sei harmlos oder notwendig, sollte sich daran erinnern, dass es meistens nicht um Meinungsaustausch geht, sondern um knallharte Interessenpolitik auf Kosten der Allgemeinheit. Es braucht deshalb mehr Transparenz, mehr Mut zur Kontrolle und mehr Distanz zwischen Geld und Gesetz. In Deutschland wurde im Jahr 2022 ein verbindliches Lobbyregister eingeführt, was löblich ist, aber leider recht lückenhaft, denn Treffen mit Ministerialbeamten unterhalb der Leitungsebene müssen nicht offengelegt werden. Wer also wie viel Geld für welchen Zweck einsetzt, bleibt immer noch im Ungefähren. Wenn sich unsere Demokratie auf Dauer behaupten will, muss sie auch wissen, wessen Ohr gehört wird.
Kommen wir zu den Themen der Woche und die sind nochmals eine Rückblende zum ATTD. Die Themenvielfalt, über die wir je bereits den einen oder anderen Überblick gegeben haben, lohnt auch den einen oder anderen detaillierteren Einblick. Wir haben Aktuelles zum iLet, schauen auf CGM als diagnostische Option, stellen den IDF-Atlas und zum Schluss die aktuelle Landscape Technology von Digital Oxygen vor. Auf geht’s!
Das US-amerikanische Medizintechnikunternehmen Beta Bionics hat mit iLet ein sogenanntes bionisches Pankreas entwickelt. iLet ist ein vollständig automatisiertes Insulin-Dosierungssystem für Menschen mit Typ-1-Diabetes, es reguliert die Blutglucose mithilfe kontinuierlicher Glukosemessung und eines lernfähigen Algorithmus, der Insulin bedarfsgerecht abgibt, ohne dass Nutzer Kohlenhydrate eingeben oder Basalraten einstellen müssen – es genügt die Angabe des Körpergewichts. Ziel des Systems ist es, die Diabetesbehandlung radikal zu vereinfachen und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern:
Nutzung von iLet-AID im Alltag
Die Insulin-only-Version wurde bereits 2023 in den USA zugelassen, eine dual-hormonelle Variante mit zusätzlichem Glucagon befindet sich in der klinischen Entwicklung. Beim ATTD zeigte Steven Russell von der US-Startup-Firma Beta Bionics Alltagsdaten mit diesem AID-System und betonte zunächst, dass glykämische Ergebnisse mit anderen Diabetes-Technologien stark mit dem Nutzungsverhalten der Anwender korrelieren. So sind z.B. häufigere tägliche Blutglucoseselbstmessungen oder Scans mit CGM-Systemen mit einer stärkeren Verbesserung der Glucosekontrolle verknüpft. Bei einer für die Zulassung wichtigen klinischen Studie mit dem iLet-AID-System zeigten sich sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern keine Korrelation zwischen der Häufigkeit der Benutzereingriffe und den erzielten glykämischen Ergebnissen:
Die Diabetes-Diagnose basiert primär auf erhöhten Nüchternglucosewerten oder den Ergebnissen eines oralen Glucosetoleranztestes, zumindest bisher. In einer bis auf den letzten Platz gefüllten Plenarsitzung an einem Vormittag beim ATTD wurde das Potenzial von CGM als neues Diagnosewerkzeug diskutiert:
CGM für die Diabetes-Diagnose?
Chantal Mathieu von der Katholieke Universiteit Leuven, Belgien, sprach als Präsidentin der EASD über die Vorteile von CGM-Systemen zur Überwachung von Menschen mit Prädiabetes oder Typ-1-Diabetes im Frühstadium, d.h. bevor diabetes-assoziierte Symptome auftreten – CGM kann bei der Vorhersage des Fortschreitens von Typ-1-Diabetes (T1D) vom Stadium 2 zum Stadium 3 helfen. Chantal Mathieu erörterte Strategien zur individuellen Vorhersage der Progressionsrate von T1D im Stadium 2 zum klinischen Stadium 3 und betonte ausdrücklich den Begriff „T1D im Stadium 2“, da viele dieser Patienten noch keine Hyperglykämie aufweisen.
Der IDF Diabetes Atlas ist eine regelmäßig aktualisierte Publikation der International Diabetes Federation. Er liefert weltweite Daten zu Diabetesprävalenz, Diagnoseraten, Gesundheitsausgaben und Risikofaktoren nach Ländern, Regionen und Altersgruppen mit dem Ziel, Politik, Forschung und Öffentlichkeit über die globale Diabeteslage zu informieren:
Der IDF-Atlas – viele Zahlen, sind es aber auch die Wichtigen?
Ein Blick in den 11. Diabetes-Atlas der International Diabetes Federation (IDF) – der erste wurde im Jahr 2000 veröffentlicht – zeigt auf über 130 Folien mit zahlreichen Tabellen und Grafiken ein eindrückliches Bild der weltweiten Diabeteslast (IDF Diabetes Atlas | Global Diabetes Data & Statistics). Gleich zu Beginn sticht eine Zahl besonders hervor: Weltweit leben derzeit 589 Millionen Erwachsene (20–79 Jahre) mit Diabetes. In Europa sind es rund 66 Millionen, das entspricht etwa einem von zehn Erwachsenen.
Wer sich einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Diabetes-Technologie verschaffen möchte, kommt an der Advanced Diabetes Technology Landscape 2025 von Digital Oxygen nicht vorbei. Die neueste Ausgabe der Landscape kartiert über 250 Unternehmen weltweit, die mit innovativen Lösungen die Versorgung von Menschen mit Diabetes verändern wollen – von etablierten Marktführern bis hin zu ambitionierten Start-ups:
Non-Invasiv messen – Wie nah sind wir dran?
Bereits zum 4. Mal wurde im Rahmen des ATTD die Technology-Landscape aktualisiert und veröffentlicht. Über 250 Unternehmen wurden gescreent und kartographiert, insbesondere in den Bereichen CGM und Non-invasive Measurement tut sich sehr viel, obwohl gerade das Segment Smart Insulin-Pens im Zusammenspiel mit AID-Software auch ein großes Potential zur Veränderung des Diabetes Management hat:
Das Bild der Woche
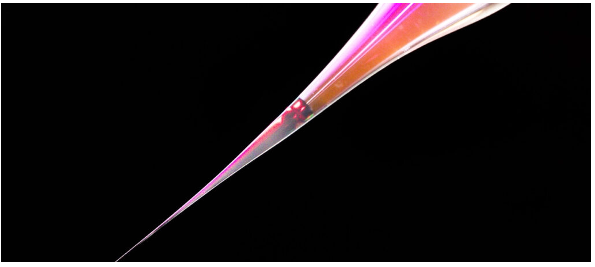
25-mal feiner als ein menschliches Haar – mit dieser Pipette können Forschende Ionen
gezielt zu einzelnen Nervenzellen befördern und diese so aktivieren.
Zum Schluss noch wie immer das Letzte
Ein Navi-System für Blinde – wie soll das denn gehen? KI macht‘s möglich, inzwischen sind KI-gestützte Navigationssysteme für blinde oder stark sehbehinderte Menschen verfügbar. Wir stellen zwei der bekanntesten Systeme in diesem Bereich vor – OrCam MyEye und Envision Glasses. Beide verwenden eine kleine Kamera, die an einer Brille angebracht ist, um visuelle Informationen in Echtzeit zu erfassen, per künstlicher Intelligenz zu analysieren und über Lautsprecher oder Kopfhörer akustisch an den Nutzer weiterzugeben.
Die OrCam MyEye ist ein kompaktes Gerät etwa in der Größe eines Fingers, das magnetisch an nahezu jede handelsübliche Brille angebracht werden kann. Es arbeitet vollständig offline und benötigt keine Internetverbindung. Die Kamera erkennt gedruckte und digitale Texte und liest diese laut vor – etwa Straßenschilder, Produktetiketten oder Speisekarten. Darüber hinaus kann die OrCam Gesichter identifizieren, Geldscheine und Farben unterscheiden sowie Barcodes und Produkte erkennen. Ihr Fokus liegt klar auf der visuellen Assistenz im Nahbereich – etwa beim Einkaufen, im öffentlichen Nahverkehr oder beim Arztbesuch. Eine klassische GPS-Navigation für längere Strecken oder zur Orientierung im Außenraum bietet die OrCam jedoch nicht. Sie ist eher ein „mobiles Auge“, das alltägliche visuelle Aufgaben übernimmt, als ein Wegweiser im engeren Sinne.
Die Envision Glasses gehen einen Schritt weiter und bieten ein umfangreicheres Spektrum an Funktionen. Sie basieren auf der Google Glass Enterprise Edition 2, sind leicht, internetfähig und verbinden sich mit dem Smartphone. Die integrierte Kamera erkennt und beschreibt die Umgebung, liest auch handschriftliche Texte vor, identifiziert Personen, Objekte und Farben und bietet bei bestehender Internetverbindung sogar eine KI-gestützte Szenenbeschreibung. In Kombination mit GPS-Apps kann das System auch zur Navigation eingesetzt werden, beispielsweise in Städten oder öffentlichen Gebäuden. Besonders hilfreich ist die Funktion „Envision Ally“, bei der Live-Videobilder an Freunde oder Helfer übertragen werden können, die dann über Sprache gezielte Unterstützung bieten – etwa bei unklaren Situationen im Straßenverkehr. Auch ein KI-Chatdienst, der visuelle Inhalte erklärt, ist integriert.
Beide Systeme verfolgen das Ziel, die Selbstständigkeit blinder Menschen im Alltag zu erhöhen. Während die OrCam besonders diskret, offline-tauglich und intuitiv ist, bieten die Envision Glasses ein breiteres Funktionsspektrum, sind jedoch auf stabile Internetverbindung und regelmäßige Updates angewiesen. Preislich liegen beide Systeme im Bereich zwischen rund 3.500 und 5.000 Euro. In Deutschland ist eine Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenkasse möglich, wenn eine anerkannte medizinische Indikation vorliegt und ein entsprechender Antrag über einen Augenarzt oder ein spezialisiertes Sanitätshaus gestellt wird. Auch Berufsgenossenschaften oder Integrationsämter können im Rahmen beruflicher Teilhabe Hilfsmittel bezuschussen.
Damit sind wir ans Ende des dieswöchentlichen weekly angekommen. Wir hoffen, unsere Freitagsinformationen und Gedanken haben Ihnen gefallen und wünschen zum Schluss noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie zuversichtlich!
Mit herzlichen Grüßen,
![]()
Dieser Artikel erscheint als Teil des wöchentlichen Letters zu hochaktuellen Entwicklungen im Bereich Diabetes Technologie. Nutzen Sie das nebenstehende Formular um sich für den diatec weekly Newsletter anzumelden!
Mit freundlichen Grüßen
![]()